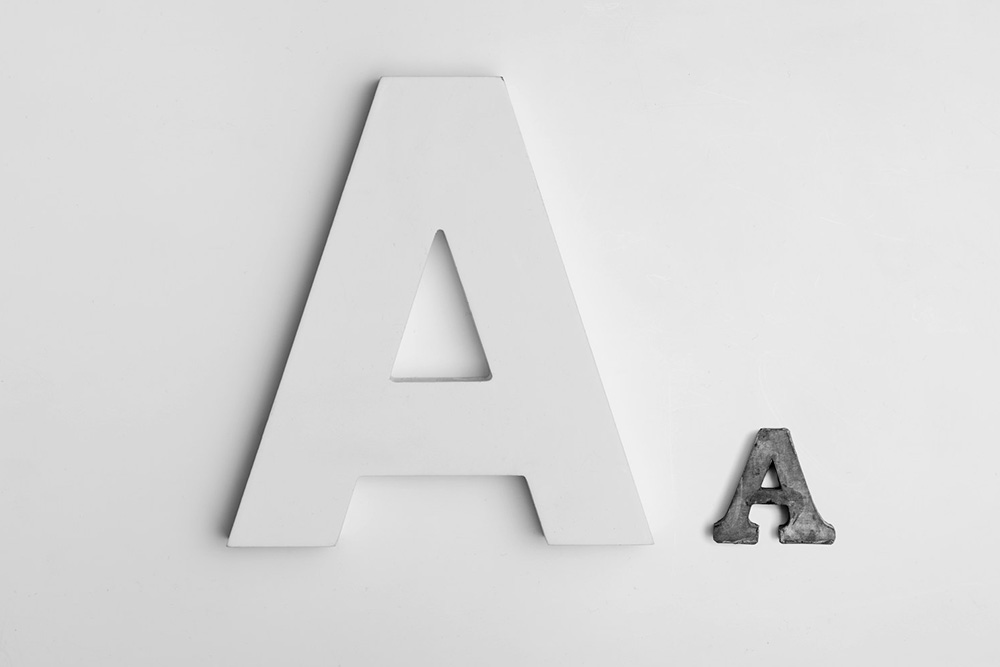Hilfe, meine Banane fliegt!
Übersetzen gehört zum Alltagsjob von Assistenzen. Seitdem das maschinelle Übersetzen per KI in den Büros Einzug gehalten hat, geht es schneller und einfacher – doch nicht immer überzeugt die Qualität. Wann Sie KI einsetzen sollten, wann nicht und worauf es beim Übersetzen im Allgemeinen ankommt.

Foto: Diane Alkier / Unsplash
Die Tage werden kürzer, das Laub verfärbt sich rot, dabei war doch gerade erst Sommer. Denken Sie da nicht auch: «Time flies like an arrow; fruit flies like a banana?» Sollten Sie des Englischen nicht mächtig sein, das Online-Übersetzungstool DeepL dolmetscht schneller, als Sie «Herbstblues» sagen können: «Die Zeit vergeht wie im Flug, Obstfliegen wie eine Banane.» Hä? Wie bitte? Womit wir beim Thema und mitten im Übersetzungsschlamassel sind, wenn wir KI-Übersetzer dort brauchen, wo wir es nicht tun sollten.
Bleiben wir kurz bei unserem Beispiel: Zwar bekommt die KI von DeepL den ersten Teil des Satzes – «Time flies like an arrow» – richtig hin, und auch Google Translate übersetzt korrekt, nämlich sinngemäss mit «Die Zeit vergeht wie im Flug». ChatGPT bietet mit «Die Zeit fliegt wie ein Pfeil» eine weitere, wörtliche Variante. Über die zweite Hälfte dieses klassischen Wortspiels hingegen stolpern alle drei Maschinen. Obstfliegen wie eine Banane? Was bitte soll das denn heissen?
Das Problem: Es handelt sich um einen Wortwitz, der nur im Englischen funktioniert und sich gar nicht ins Deutsche übersetzen lässt – höchstens erklären. Der Witz entsteht dadurch, dass im Englischen mit der doppelten Bedeutung von «flies» und «like» gespielt wird. Nur der Kontext verrät, ob mit «flies» das Verb «fliegen» oder das Substantiv «die Fliege» gemeint ist respektive mit «like» die vergleichende Konjunktion «wie» oder das Verb «mögen». Wie Sie bestimmt schon herausgefunden haben: Verb und Substantiv sind richtig, und korrekt ins Deutsche übersetzt heisst der zweite Teilsatz: «Fruchtfliegen mögen eine Banane.» Inhaltlich macht das zwar mehr Sinn, aber das Wortspiel funktioniert dennoch nicht.
Das ist also des Pudels Kern: Maschinelle Übersetzung hat ihre Grenzen, und die sollten Sie kennen. Zugegeben, als Assistentin werden Sie im Alltag kaum vor solchen kniffligen Wortspielen stehen. Aber das Beispiel zeigt, wo KI-Tools an ihre Grenzen stossen: bei Mehrdeutigkeiten, kulturellen Feinheiten und allem, was zwischen den Zeilen steht.
Wie funktionieren KI-Übersetzer?
Vereinfacht erklärt: Moderne KI-Übersetzungstools basieren auf neuronalen Netzen, die mit riesigen Mengen zweisprachiger Texte trainiert werden. Dabei lernen sie nicht Wortlisten auswendig, sondern erkennen statistische Muster: welche Wörter und Satzstrukturen in der Zielsprache mit welchen im Ausgangstext typischerweise zusammenfallen.
Zum Beispiel: Wenn im deutschen Text das Wort «Haus» vorkommt, taucht im englischen Text häufig das Wort «house» auf. Oder: Wenn im Englischen ein Satz mit «if» beginnt, dann steht im Deutschen oft «wenn» am Anfang. Das klingt für menschliche Ohren banal, aber für Maschinen sind derartige Erkenntnisse eine Mammutaufgabe. Jedenfalls entstehen so Modelle, die Übersetzungen auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten generieren, allerdings ohne das Gesagte wirklich zu verstehen.
Wie arbeiten menschliche Übersetzungsprofis?
Menschliche Übersetzerinnen und Übersetzer hingegen greifen auf Weltwissen und persönliche Erfahrung zurück. Sie kennen nicht nur die Wörter, sondern auch die Dinge und Konzepte, die dahinterstehen. Sie haben vermutlich schon in einem Haus gewohnt, sie wissen, dass ein Chalet im Wallis anders aussieht als ein Reihenhaus in London und dass die Wahl eines Begriffs vom kulturellen und situativen Kontext abhängt.
Menschliche Profis schauen also auf:
- Sinn statt Wort: Übersetzen bedeutet nicht, Wörter eins zu eins in eine andere Sprache zu übertragen, sondern den Sinn zu verstehen und diesen in der Zielsprache auszudrücken.
- Textfunktion: Sie analysieren, welche Funktion der Text im Ausgangskontext hat (zum Beispiel informieren, werben, instruieren) und wie diese Funktion in der Zielsprache erfüllt werden kann.
- Adressatenorientierung: Sie berücksichtigen immer das Zielpublikum: Was versteht es, welche Konventionen gelten?
Professionelle Übersetzerinnen und Übersetzer übertragen also nicht Wörter von einer Sprache in die andere, sondern formulieren einen Text in der Zielsprache neu so, dass er muttersprachlich klingt, inhaltlich korrekt bleibt und seine Funktion erfüllt.
Besser Mensch oder Maschine für tägliche Übersetzungsaufgaben?
In Ihrem Alltag jonglieren Sie mit verschiedensten Texten. Die gute Nachricht: Für viele davon sind KI-Tools perfekt geeignet, ob DeepL, Google Translate oder ChatGPT. Die interne E-Mail an die Kollegin in der Romandie? In Sekunden erledigt. Die Zusammenfassung eines englischen Fachartikels? Kein Problem. Terminbestätigungen, Workshop-Agenden, Standardkorrespondenz, all das meistern die Maschinen zuverlässig.
Vorsicht geboten ist hingegen beispielsweise bei Geschäftsberichten für Aktionärinnen und Aktionäre, Marketing- und Werbetexten, juristischen Dokumenten, kulturell sensiblen Inhalten oder wenn die spezifische Unternehmenstonalität getroffen werden muss. Hier sind nach wie vor menschliche Profis gefragt, zumindest für den Feinschliff. Denn auch die Fachleute arbeiten heute nicht mehr «solo», sondern mit Maschinen zusammen.
Fabio Schmuki vom Schweizer KI-Übersetzer Supertext bestätigt: «Bei wichtigen Texten lohnt sich eine Kombination mit menschlichen Übersetzerinnen und Übersetzern oft. Mit unserem Profi-Check-Feature zum Beispiel liefert die KI sofort ein Resultat – und Nutzende können dann selbst entscheiden, ob sie die Übersetzung von Spezialistinnen und Spezialisten prüfen und, wo nötig, korrigieren lassen wollen.» Ein weiterer, wichtiger Aspekt beim Übersetzen mit KI ist die Einhaltung von Datenschutzstandards: «Wir erfüllen die Anforderungen von DSG und DSGVO und hosten unsere KI-Systeme ausschliesslich auf Servern in der Schweiz», sagt Schmuki.
Die Supertext-KI kann aber auch allein genutzt werden, wenn es schneller gehen soll oder kein Profi-Einsatz nötig ist, sagt der Experte. «Und unsere KI deckt auch Sprachen ab, die bei anderen Anbietenden gar nicht verfügbar sind – etwa Rätoromanisch, Schweizerdeutsch, Albanisch, Kroatisch oder Serbisch.» Damit eröffnet sich Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, Übersetzungen für Sprachen zu erhalten, die bisher in vielen gängigen Tools wie etwa DeepL fehlen.
Unser Fazit für Sie als Assistenz lautet: Nutzen Sie KI-Übersetzer als hilfreiche Werkzeuge, die Zeit sparen und die Arbeit erleichtern. Aber behalten Sie im Hinterkopf: Damit Ihnen in Ihren Texten keine Bananen um die Ohren fliegen, ist die letzte Instanz für die Qualität immer der Mensch – also Sie.
Wofür sie sich KI-Übersetzer eignen und wofür nicht
Problemloser Einsatz von KI
- Für den schnellen Überblick: DeepL oder Google Translate reichen völlig, wenn Sie nur verstehen möchten, worum es geht.
- Für interne Kommunikation: ChatGPT übersetzt nicht nur, sondern formuliert auf Ihren Prompt hin direkt in der Zielsprache.
Wann Sie die Finger von KI lassen sollten
- Kreative Texte: Slogans und Werbekampagnen brauchen menschliches Fingerspitzengefühl.
- Rechtliche Dokumente: Ein Übersetzungsfehler kann teuer werden.
- Kulturell sensible Inhalte: Was hier höflich klingt, kann anderswo eine Beleidigung sein.
- Spezieller Fachjargon: Medizinische oder technische Texte erfordern Expertenwissen.