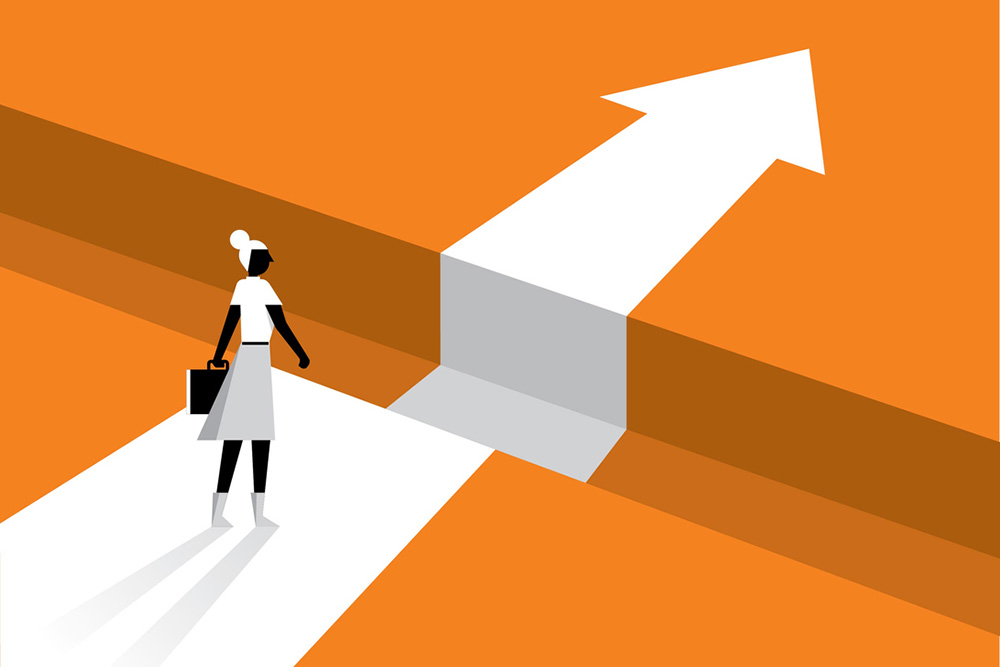Solidarität im Wandel
Die Sozialversicherungen bilden in der Schweiz einen zentralen, gesellschaftlichen Pfeiler. Sie dienen nicht nur der individuellen Absicherung gegen Lebensrisiken wie Alter, Krankheit oder Invalidität, sondern beruhen wesentlich auf dem Prinzip der Solidarität.

Foto: iStock
Dieses solidarische Gefüge steht jedoch zunehmend unter Druck. Demografische Veränderungen, wirtschaftliche Entwicklungen und der gesellschaftliche Wertewandel werfen grundlegende Fragen zur Belastbarkeit und Zukunftsfähigkeit dieses Systems auf. Die Herausforderung besteht darin, das Gleichgewicht zwischen den Generationen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den sozialen Ausgleich sowohl innerhalb von wie auch zwischen Altersgruppen zu sichern.
Grundlagen der Solidarität
Solidarität bezeichnet das Prinzip der gegenseitigen Unterstützung innerhalb einer definierten Gemeinschaft. Diese erfolgt unabhängig von der individuellen Inanspruchnahme oder persönlichen Risikosituation und basiert auf dem Grundgedanken, dass alle Mitglieder zum System beitragen und im Bedarfsfall Leistungen beziehen können. In der Sozialversicherung zeigt sich die Solidarität dadurch, dass Beiträge vielfach einkommensabhängig erhoben und Leistungen bedarfsorientiert ausgerichtet werden.
Die schweizerischen Sozialversicherungen basieren auf einem Zusammenspiel von Bundesgesetzen, kantonalen Zuständigkeiten und diversen Institutionen. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens wird Solidarität durch verpflichtende Beiträge, staatliche Zuschüsse und Ausgleichsmechanismen organisiert. Die Finanzierungssysteme – insbesondere das Umlage- und das Kapitaldeckungsverfahren – bestimmen massgeblich, in welcher Form Solidarität zwischen den Generationen verankert ist.
Unterschiedliche Ausgangslagen
Die AHV basiert auf dem Umlageverfahren, bei dem Beitragspflichtige die laufenden Renten der älteren Generation finanzieren. Sehr vereinfacht gesagt: Was wir heute an AHV-Beiträgen einzahlen, wird morgen in Form von Leistungen ausbezahlt. Dieses Modell beruht auf einem impliziten Generationenvertrag, der jedoch durch die zunehmende Überalterung der Bevölkerung stark unter Druck steht. Gleichzeitig steht die langfristige Finanzierbarkeit auf einem sehr fragilen Fundament.
Ähnlich verhält es sich bei der IV, wo die generationenübergreifende Solidarität in Form der Absicherung gemeinsamer Lebensrisiken besteht. Auch sie finanziert sich durch Beiträge der Erwerbstätigen wie auch Nichterwerbstätigen, mit denen etwa Massnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung oder die IV-Renten von Betroffenen finanziert werden.
Auch bei der Krankenversicherung existieren starke solidarische Elemente: Leistungsbeziehende Personen verursachen höhere Kosten, zahlen aber gleich hohe Prämien wie Personen, die keine Leistungen in Anspruch nehmen. Diese vertikale und horizontale Umverteilung wird über Ausgleichsmechanismen und Prämienverbilligungen unterstützt.
Das BVG basiert primär auf individueller Kapitalbildung. Dennoch bestehen solidarische Elemente, etwa in der kollektiven Risikoabsicherung oder bei Umverteilungswirkungen über den Umwandlungssatz. Jüngere Generationen tragen zunehmend die Last sinkender Renditen und steigender Lebenserwartung älterer Jahrgänge, was zu einer nicht gewünschten und vor allem nicht gesetzlich vorgesehenen Umverteilung führt.
Formen der Solidarität im Generationenvergleich
Diese klassische Form der vertikalen Solidarität zeigt sich vor allem im Umlageverfahren der AHV. Die sogenannte aktive Generation trägt die aktuelle Finanzierungslast und erhält im Gegenzug eine künftige Leistungszusage, deren Realisierung aber zunehmend mit Unsicherheiten behaftet ist. Als Beispiele für die horizontale Solidarität gelten der Risikoausgleich in der Krankenversicherung oder kollektive Vorsorgeelemente im BVG. Diese Form ergänzt die vertikale Solidarität, wirkt aber hauptsächlich innerhalb derselben Altersgruppe.
Die meisten Formen der Solidarität sind gesetzlich geregelt. Ergänzend existieren freiwillige Unterstützungsstrukturen wie familiäre Pflege oder private Vorsorge. Diese tragen zwar in gewisser Weise zu einer Gesamtstabilität bei, sind jedoch nicht systematisch abgesichert.
Herausforderungen und Spannungsfelder
Die steigende Lebenserwartung bei sinkender Geburtenrate verschärft die finanzielle Schieflage der AHV. Der Ausgleich zwischen den Generationen gerät zunehmend in ein Ungleichgewicht. Zudem treffen die steigenden Sozialausgaben auf eine schmalere Finanzierungsbasis. Das führt unweigerlich zu Fragen, wie diese Lastenverteilung zwischen heutigen und künftigen Generationen gerecht ausgestaltet werden kann.
In der direkten Demokratie treffen unterschiedliche Generationeninteressen unmittelbar aufeinander. Das jüngste Musterbeispiel dazu sind die zahlreichen Diskussionen vor der Abstimmung zur 13. AHV-Altersrente und aktuell die unterschiedlichen Auffassungen, wie diese finanziert werden sollte. Reformen müssen deshalb politisch gut abgestützt und gesellschaftlich breit legitimiert sein.
Wohin des Weges?
Liegt der Schlüssel darin, einen fairen Ausgleich durch flexiblere Rentenmodelle oder automatisierte Anpassungsmechanismen zu erzielen? Oder muss der Hebel bei Beitragserhöhungen und weiteren Anpassungen des Pensionsalters angesetzt werden? Spielt plötzlich der einstige Gedanke, das effektive Renteneintrittsalter an die statistische Lebenserwartung zu koppeln, wieder eine Rolle innerhalb der Diskussionen? Oder ist ein vollständiges Neu- und Umdenken der aktuellen Systematik ein Lösungsansatz?
Die Sozialversicherungen der Schweiz beruhen auf einem tragfähigen Solidaritätsprinzip, das besonders im Verhältnis zwischen den Generationen zum Ausdruck kommt. Angesichts demografischer und ökonomischer Herausforderungen bedarf es jedoch gezielter Reformen, um dieses Prinzip langfristig aufrechtzuerhalten. Die Zukunft der Generationensolidarität hängt entscheidend davon ab, wie tragfähig, gerecht und transparent das System ausgestaltet wird – und ob es gelingt, das Vertrauen aller Generationen darin zu erhalten.